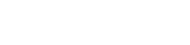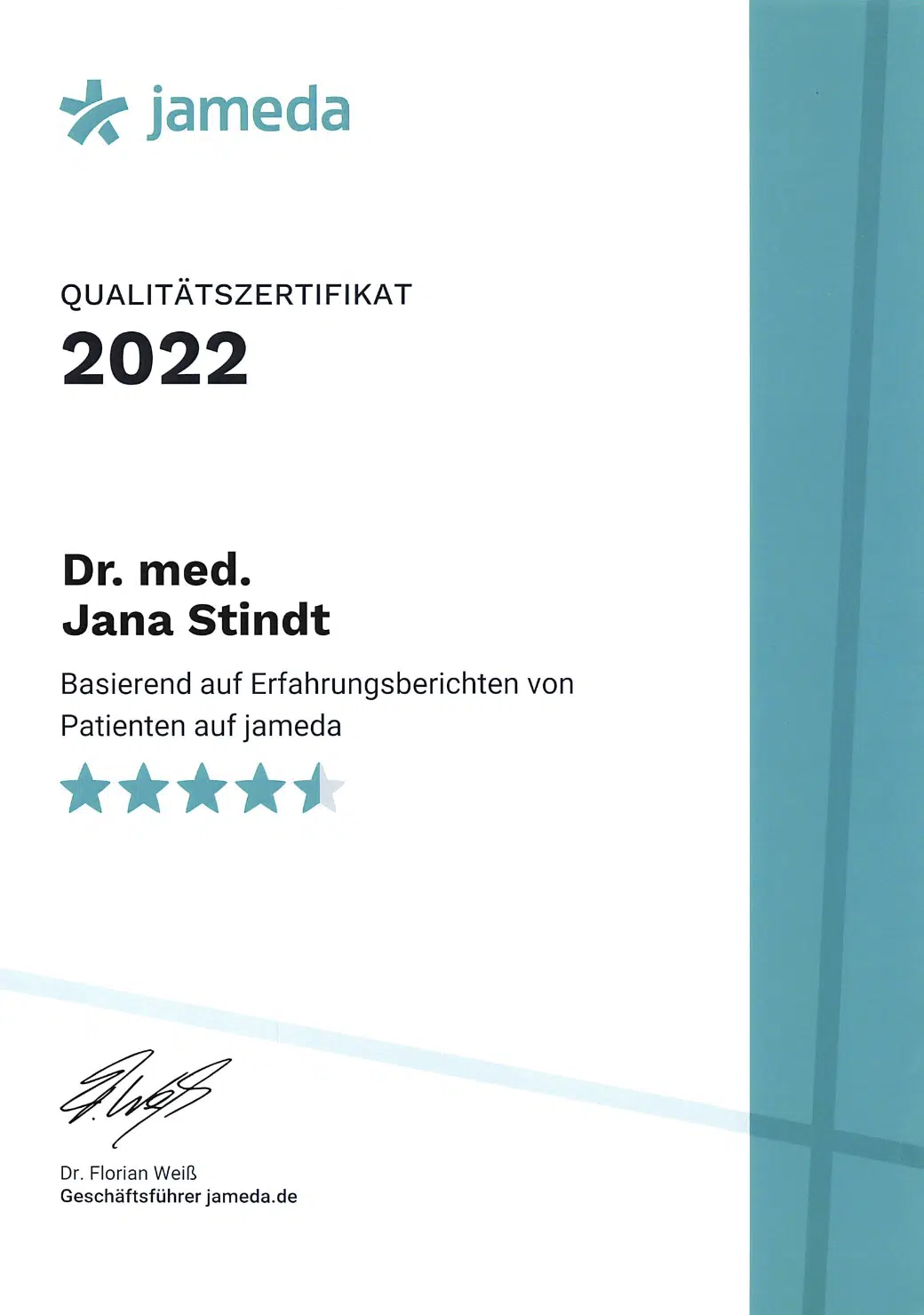Über Geschlechtskrankheiten spricht niemand gern. Doch gerade diese Zurückhaltung kann gefährlich werden, denn viele sexuell übertragbare Infektionen verlaufen zunächst ohne spürbare Anzeichen. Tatsächlich bemerken bis zu 80 Prozent der betroffenen Frauen keine Symptome bei einer Chlamydien-Infektion (Robert Koch-Institut). Dabei sind die meisten Geschlechtskrankheiten gut behandelbar, wenn sie rechtzeitig erkannt werden.
Das Wichtigste in Kürze
- Symptome oft unsichtbar: Viele Geschlechtskrankheiten verlaufen bei Frauen ohne erkennbare Anzeichen und bleiben daher unentdeckt.
- Typische Warnsignale: Veränderter Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, Unterleibsschmerzen oder Zwischenblutungen können auf eine Infektion hinweisen.
- Folgen bei Nichtbehandlung: Unbehandelte sexuell übertragbare Infektionen können zu Unfruchtbarkeit, chronischen Entzündungen oder Eileiterschwangerschaften führen.
- Früherkennung rettet: Die meisten Geschlechtskrankheiten sind bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar und hinterlassen keine bleibenden Schäden.
- Kostenloser Test: Frauen unter 25 Jahren können einmal jährlich kostenlos auf Chlamydien getestet werden, da diese Altersgruppe besonders gefährdet ist.

Symptome und Risiken: Was Frauen wissen sollten
Der weibliche Körper ist anatomisch anfälliger für Geschlechtskrankheiten. Die Schleimhaut der Scheide bietet Krankheitserregern eine größere Angriffsfläche, und Symptome fallen bei Frauen oft milder aus oder bleiben ganz aus. Unbehandelte Infektionen können von der Scheide über den Gebärmutterhals bis in die Eileiter aufsteigen und dort ernsthafte Schäden verursachen.
Typische Symptome bei Frauen sind: Veränderter Ausfluss (übelriechend, verfärbt, schaumig), Brennen beim Wasserlassen, Unterleibsschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Zwischenblutungen, Bläschen oder Warzen im Intimbereich sowie geschwollene Lymphknoten in der Leiste.
Das größte Problem ist jedoch der symptomlose Verlauf. Bei Chlamydien zeigen etwa 80 Prozent der betroffenen Frauen keine Beschwerden, bei Gonorrhö ist es etwa die Hälfte. Trotzdem können unbehandelte Infektionen zu Unfruchtbarkeit führen. Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 100.000 Frauen aufgrund von Chlamydien-Infektionen ungewollt kinderlos (Fernarzt Studie, 2023).
Wichtig: Nicht jede Beschwerde im Intimbereich ist eine STI. Lichen sclerosus ist zum Beispiel eine nicht ansteckende, chronisch-entzündliche Hauterkrankung im Vulva‑/Damm‑Bereich. Typisch sind anhaltender Juckreiz und weißliche, papierartige Hautveränderungen. Auch hier ist eine frühe ärztliche Abklärung wichtig, um Beschwerden zu lindern und Narben/Verengungen zu vermeiden.
Die 10 häufigsten Geschlechtskrankheiten bei Frauen
1. Chlamydien: Die häufigste bakterielle Geschlechtskrankheit
Chlamydien sind winzige Bakterien, die sich in den Körperzellen einnisten und dort vermehren. In Deutschland stecken sich jährlich etwa 300.000 Frauen mit dem Erreger Chlamydia trachomatis an (Vorsorge Online, 2021). Besonders betroffen sind junge Frauen zwischen 16 und 19 Jahren.
Symptome bei Frauen
Die große Gefahr liegt darin, dass 70 bis 80 Prozent der infizierten Frauen keinerlei Beschwerden bemerken. Wenn Symptome auftreten, dann meist ein bis drei Wochen nach der Ansteckung. Typisch sind eitriger oder übelriechender Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, Juckreiz im Intimbereich und Zwischenblutungen. Auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr können auftreten.
Mögliche Folgen bei Nichtbehandlung
Unbehandelt steigen die Bakterien von der Scheide über den Gebärmutterhals, die Zervix, bis in die Eileiter auf. Dort können sie schwere Entzündungen verursachen, die zu Verklebungen führen. Diese Verklebungen sind eine der Hauptursachen für Unfruchtbarkeit bei Frauen. Etwa 10 bis 40 Prozent der unbehandelten Chlamydien-Infektionen führen zu solchen Komplikationen.
Behandlung – was kommt auf mich zu?
Die Behandlung ist in der Regel unkompliziert und zeitlich überschaubar. Nach dem Test bespricht die Ärztin das passende Vorgehen, erklärt, wie lange Sie etwas einnehmen oder anwenden sollen und ob eine Kontrolle sinnvoll ist. Wichtig ist, dass auch Sexualpartner informiert, getestet und – falls nötig – mitbehandelt werden, damit es nicht zu erneuten Ansteckungen kommt.
Kostenloser Test für junge Frauen
Frauen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr haben Anspruch auf einen kostenlosen Chlamydien-Test einmal pro Jahr. Dieser wird über die Krankenkasse abgerechnet und kann bei Ihrer Frauenärztin durchgeführt werden.

2. HPV: Humane Papillomviren und das Risiko für Gebärmutterhalskrebs
Humane Papillomviren, kurz HPV, sind die häufigsten sexuell übertragbaren Viren überhaupt. Etwa 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben mit HPV (Frauenärzte im Netz). In Deutschland sind schätzungsweise 6 Millionen Frauen mit HPV infiziert.
Verlauf und Selbstheilung
Bei etwa 90 Prozent der betroffenen Frauen heilt die Infektion innerhalb von zwei Jahren von selbst aus, ohne dass es zu Problemen kommt. Nur bei etwa 10 Prozent bleibt die Infektion bestehen und kann dann zu Zellveränderungen führen.
Symptome bei Frauen
Die meisten HPV-Infektionen verlaufen ohne erkennbare Symptome. Einige HPV-Typen, die sogenannten Niedrigrisiko-Typen, können jedoch Feigwarzen verursachen. Diese zeigen sich als kleine, hautfarbene bis rötliche Knötchen oder Warzen im Intimbereich. Sie sind zwar unangenehm, aber nicht gefährlich.
Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs
Die Hochrisiko-HPV-Typen 16 und 18 sind für etwa 70 Prozent aller Gebärmutterhalskrebserkrankungen verantwortlich. In Deutschland erkranken jährlich etwa 4.600 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, rund 1.600 Frauen sterben daran (Robert Koch-Institut, 2022). Von der Infektion bis zur Krebsentstehung vergehen meist 10 bis 20 Jahre.
Früherkennung und Vorsorge
Frauen ab 20 Jahren haben Anspruch auf einen jährlichen Pap-Abstrich (Zellabstrich vom Gebärmutterhals zur Früherkennung) beim Frauenarzt. Ab 35 Jahren wird alle drei Jahre ein kombinierter HPV-Test (Labortest zum Nachweis von Hochrisiko‑HPV) mit Pap-Abstrich durchgeführt. Diese Vorsorgeuntersuchungen können Zellveränderungen frühzeitig erkennen, lange bevor Krebs entsteht.
Die HPV-Impfung schützt: Die Ständige Impfkommission empfiehlt die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren, also vor dem ersten sexuellen Kontakt. Die Impfung schützt vor den gefährlichsten HPV-Typen und kann das Risiko für Gebärmutterhalskrebs deutlich senken. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse bis zum 18. Lebensjahr.
3. Gonorrhö (Tripper): Die oft übersehene bakterielle Infektion
Gonorrhö betrifft viele Frauen gerade deshalb, weil sie häufig still verläuft und sich nicht nur auf die Scheide, sondern auch auf Rachen oder Enddarm ausbreiten kann. Eine gleichzeitige Infektion mit Chlamydien ist möglich, daher werden oft Kombitests empfohlen. In der Schwangerschaft kann eine unbehandelte Gonorrhö das Risiko für Komplikationen erhöhen, Neugeborene können sich unter der Geburt an den Augen infizieren.
Gonorrhö, im Volksmund Tripper genannt, wird durch Bakterien namens Gonokokken ausgelöst. Diese Geschlechtskrankheit gehört weltweit zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. Die WHO schätzt etwa 87 Millionen Neuinfektionen pro Jahr (gesund.bund.de).
Symptome bei Frauen
Das Tückische ist, dass etwa 50 Prozent der infizierten Frauen keine oder nur sehr milde Symptome entwickeln. Wenn Beschwerden auftreten, dann meist grünlich-gelber, übelriechender Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, Zwischenblutungen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Die Symptome zeigen sich typischerweise 1 bis 14 Tage nach der Ansteckung.
Risiko für die Fruchtbarkeit
Unbehandelt können die Bakterien von der Scheide über den Gebärmutterhals bis in die Eileiter und Eierstöcke aufsteigen. Dort verursachen sie Entzündungen, die zu dauerhaften Verklebungen und damit zur Unfruchtbarkeit führen können. Auch Eileiterschwangerschaften sind eine mögliche Folge.
Behandlung: So läuft es ab
Nach gesichertem Nachweis erhalten Sie eine zielgerichtete, kurze Therapie, die in den meisten Fällen rasch wirkt. Partner sollten zeitnah mitgetestet und bei Bedarf zeitgleich behandelt werden, um den „Ping‑Pong‑Effekt“ zu vermeiden. Eine kurze Nachkontrolle kann sinnvoll sein, insbesondere wenn Beschwerden fortbestehen oder eine Schwangerschaft vorliegt.

4. Genitalherpes: Die lebenslange Virusinfektion
Für viele Betroffene ist vor allem der erste Ausbruch belastend, da er ausgeprägter verlaufen kann. Auch ohne sichtbare Bläschen kann das Virus zeitweise ausgeschieden werden, weshalb Ansteckungen in beschwerdearmen Phasen möglich sind. In der Schwangerschaft wird gegen Ende besonders sorgfältig geschaut, ob aktive Herpesläsionen vorliegen, um das Geburtsmanagement abzustimmen.
Genitalherpes wird hauptsächlich durch das Herpes-simplex-Virus Typ 2, kurz HSV-2, ausgelöst. In Deutschland tragen schätzungsweise 10 bis 15 Prozent der Menschen dieses Virus in sich. Frauen sind häufiger betroffen, da ihre Schleimhäute empfindlicher sind.
Symptome bei Frauen
Viele Infektionen verlaufen ohne erkennbare Beschwerden. Wenn Symptome auftreten, beginnen sie oft mit Kribbeln oder Brennen im Intimbereich. Danach bilden sich schmerzhafte Bläschen an Schamlippen, Scheide oder Gebärmutterhals. Diese platzen auf, nässen und verkrusten. Begleitend können Fieber und Lymphknotenschwellungen auftreten.
Ansteckung und Verlauf
Die Übertragung erfolgt über engen Haut- und Schleimhautkontakt. Eine Ansteckung ist auch ohne sichtbare Bläschen möglich. Nach der Erstinfektion bleibt das Virus im Körper und kann durch Stress, Erkältungen oder hormonelle Veränderungen reaktiviert werden. Rezidive (Wiederauftreten der Beschwerden) verlaufen meist milder als der erste Ausbruch.
Diagnose und Behandlung
Zunächst klärt die Ärztin per Untersuchung und gegebenenfalls Abstrich, ob ein akuter Ausbruch vorliegt. Bei Erst- oder stärkeren Schüben wird eine zeitlich begrenzte Therapie eingeleitet, die Beschwerden lindert und die Dauer verkürzt. Bei häufigen Rückfällen kann eine vorbeugende Strategie besprochen werden (zum Beispiel Auslöser identifizieren, Stress reduzieren, Haut schonen). Während eines Ausbruchs sollten Sie auf sexuelle Kontakte verzichten; Kondome senken das Risiko in beschwerdearmen Phasen.
5. Trichomoniasis: Häufig, aber oft unentdeckt
Trichomonaden sind bewegliche Einzeller, die sich vor allem in der Scheide wohlfühlen, wenn der pH-Wert erhöht ist. Sie können Entzündungen begünstigen und die Schleimhaut empfindlicher für andere Erreger machen. Da viele Frauen keine deutlichen Beschwerden haben, wird die Diagnose häufig erst im Rahmen eines Abstrichs gestellt.
Trichomoniasis wird durch den Parasiten Trichomonas vaginalis verursacht. Sie ist eine der häufigsten heilbaren sexuell übertragbaren Infektionen weltweit.
Symptome bei Frauen
Bei Frauen zeigt sich Trichomoniasis häufig durch gelblich-schaumigen, oft stark riechenden Ausfluss, begleitet von Juckreiz, Brennen beim Wasserlassen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr; etwa die Hälfte der Infektionen verläuft jedoch ohne Beschwerden.
Folgen und Besonderheiten
Unbehandelt kann Trichomoniasis Entzündungen begünstigen. In der Schwangerschaft steigt das Risiko für Frühgeburten. Eine Infektion kann die Anfälligkeit für andere STI erhöhen.
Diagnose und Behandlung
Nach dem Nachweis erfolgt eine kurze, gut verträgliche Therapie, die meist als Einmal‑ oder Kurzzeitbehandlung ausreicht. Partner werden mitgetestet und bei Bedarf gleichzeitig behandelt. Eine Nachkontrolle wird individuell vereinbart.

6. Syphilis: Die wieder zunehmende Infektion
Syphilis verläuft in mehreren Stadien und kann unbehandelt Nerven, Herz‑Kreislauf‑System und andere Organe schädigen. In Deutschland wurden 2024 insgesamt 9.519 Fälle gemeldet, ein neuer Höchststand nach 9.159 Fällen im Jahr 2023 (RKI, Epidemiologisches Bulletin 39/2025). Das verdeutlicht, dass frühzeitige Tests und Therapien weiterhin wichtig sind.
Symptome bei Frauen
Im frühen Stadium zeigt sich an der Eintrittsstelle häufig ein kleines, schmerzloses Geschwür, das von allein abheilen kann. Wochen später können Hautausschlag an Rumpf, Handflächen oder Fußsohlen, Fieber, Halsweh, Kopf‑ und Gliederschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten auftreten. Ohne Behandlung sind Spätfolgen wie Nervenschäden, Herzbeteiligung oder Schäden an anderen Organen möglich.
Behandlung: Was kommt auf mich zu?
Nach der gesicherten Diagnose bespricht die Ärztin das Stadium und das passende Vorgehen. Ziel ist, die Infektion zuverlässig zu stoppen und Spätfolgen zu verhindern. Dazu gehören eine gut planbare, zeitlich begrenzte Therapie, Verlaufskontrollen mit Bluttests sowie die Information von Sexualpartnern. Während und kurz nach der Behandlung sollten Sie Sex mit Kondom praktizieren oder pausieren, bis die Ärztin Entwarnung gibt.
7. HIV: Das Immunschwäche‑Virus
Für Frauen spielt neben der Sexualübertragung auch die Gesundheit des Genitaltrakts eine Rolle, da Entzündungen die Anfälligkeit erhöhen können. Ein regelmäßiger Test ist sinnvoll, wenn Risikosituationen bestanden, denn eine frühe Therapie schützt die eigene Gesundheit und senkt die Weitergabe.
Symptome bei Frauen
Kurz nach der Ansteckung treten häufig grippeähnliche Beschwerden mit Fieber, Abgeschlagenheit und geschwollenen Lymphknoten auf. Danach folgt oft eine längere Phase ohne erkennbare Symptome. Später können wiederkehrende Infektionen, Gewichtsverlust oder Nachtschweiß Hinweise geben.
Behandlung: Was bedeutet das im Alltag?
Die heutige HIV‑Therapie ist sehr wirksam. Ziel ist es, die Virusmenge im Blut so weit zu senken, dass Sie gesund bleiben und HIV beim Sex nicht weitergeben (U=U: unter Nachweisgrenze = nicht übertragbar). Das gelingt durch eine individuell abgestimmte, tägliche Behandlung und regelmäßige Kontrollen. Zusätzlich schützen Kondome; eine vorbeugende Option (PrEP) kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein – die Praxis berät dazu persönlich.

8. Hepatitis B: Virusinfektion mit Leberbeteiligung
Hepatitis B wird über Blut und Körperflüssigkeiten übertragen, dazu zählt auch ungeschützter Geschlechtsverkehr. In der Schwangerschaft kann das Virus auf das Kind übergehen, vor allem während der Geburt. Die Schutzimpfung ist sehr wirksam und in Deutschland empfohlen; Ihren Impfstatus prüfen wir gern in unserer Praxis in Oldenburg.
Symptome bei Frauen
Viele Infektionen verlaufen zunächst unauffällig. Möglich sind Müdigkeit, verminderter Appetit, Übelkeit, dunkler Urin oder eine Gelbfärbung der Haut. Beschwerden sagen wenig über die Schwere aus, daher sind Blutuntersuchungen wichtig.
Behandlung: Worauf kommt es an?
Bei frischen, unkomplizierten Verläufen reichen oft Kontrollen und Schonung, der Körper klärt die Infektion häufig selbst. Bei länger anhaltenden oder chronischen Verläufen wird individuell entschieden, wie die Leber bestmöglich geschützt wird; regelmäßige Blutwerte und Ultraschall gehören dann dazu. Kondome reduzieren das Übertragungsrisiko, Partner können ihren Impfstatus prüfen und auffrischen lassen.
9. Mykoplasmen und Ureaplasmen
Diese Keime können zur normalen Scheidenflora gehören. Mycoplasma genitalium wird als sexuell übertragbarer Erreger anerkannt und kann Entzündungen am Gebärmutterhals verursachen; viele Infektionen verlaufen jedoch symptomarm. Wichtig ist deshalb die ärztliche Abklärung bei wiederkehrenden Beschwerden.
Symptome bei Frauen
Möglich sind vermehrter oder veränderter Ausfluss, Brennen beim Wasserlassen, Juckreiz sowie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Da die Beschwerden unspezifisch sind, klärt die Ärztin mit Abstrich und Labor den genauen Erreger.
Behandlung: Wie wird entschieden?
Behandelt wird nur, wenn Beschwerden bestehen und der Erreger sicher nachgewiesen ist. Ziel ist es, Symptome zu lindern und Folgeschäden zu verhindern – so kurz wie möglich, so lang wie nötig. Oft ist auch eine Mituntersuchung des Partners sinnvoll, um erneute Ansteckungen zu vermeiden.

10. Scheidenpilz (Candida)
Pilzinfektionen der Scheide sind häufig, werden meist durch Candida albicans ausgelöst und gelten nicht als klassische Geschlechtskrankheit. Das Risiko steigt, wenn die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht gerät, etwa nach Antibiotika, bei Diabetes, in der Schwangerschaft oder bei hormonellen Veränderungen.
Symptome bei Frauen
Typisch sind starker Juckreiz, Rötung und Brennen im Intimbereich. Häufig kommt ein weißlich‑krümeliger Ausfluss hinzu, gelegentlich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder beim Wasserlassen. Die Beschwerden können schwanken und sind nicht immer eindeutig von anderen Ursachen zu unterscheiden, weshalb eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist, wenn Beschwerden wiederkehren.
Behandlung: Was hilft zuverlässig?
In unkomplizierten Fällen reicht meist eine kurze, lokal angewendete Therapie, über die Sie in Praxis oder Apotheke beraten werden. Bei wiederkehrenden Infektionen prüfen wir mögliche Auslöser und planen gemeinsam ein stufenweises Vorgehen (zum Beispiel über mehrere Zyklen). Baumwollunterwäsche, schonende Intimpflege und das Vermeiden von übermäßiger Intimreinigung unterstützen die Genesung.
Wann sollten Frauen zur Ärztin gehen?
Sie sollten einen Termin vereinbaren, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen bemerken:
- Neuer oder veränderter Ausfluss, besonders wenn er übel riecht oder verfärbt ist.
- Brennen beim Wasserlassen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
- Zwischenblutungen oder Blutungen nach dem Sex.
- Bläschen, Warzen oder wunde Stellen im Intimbereich.
- Unterleibsschmerzen oder geschwollene Lymphknoten in der Leiste.
- Schwangerschaft und der Verdacht auf eine Infektion.
Eine frühe Abklärung schützt die Gesundheit und verhindert Spätfolgen. In unserer Oldenburger Praxis erhalten Sie eine einfühlsame und diskrete Beratung.
Schutz und Prävention
Ein guter Schutz beginnt nicht erst im Schlafzimmer, sondern mit Wissen und klaren Absprachen. Viele STI verlaufen zunächst unauffällig, wer Risiken kennt und einfache Routinen etabliert, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung deutlich.
- Kondome richtig anwenden: Sie senken das Risiko deutlich.
- HPV‑ und Hepatitis‑B‑Impfung: Fragen Sie nach Ihrem Impfstatus.
- Regelmäßige Vorsorge: Pap‑Abstrich und, je nach Alter, HPV‑Test.
- Partnerkommunikation: Offenes Gespräch, gemeinsame Tests bei neuen Partnerschaften.
- Intimpflege mit Maß: Milde Produkte, kein aggressives Spülen.
- Frühe Behandlung: Bei Beschwerden nicht abwarten, sondern untersuchen lassen.
Prävention ist alltagstauglich: Ein Kondom griffbereit zu haben, den Impfpass zu prüfen und bei neuen Partnerschaften ein gemeinsames Testgespräch zu führen, schafft Sicherheit, ohne Angst zu machen. Wenn Sie unsicher sind, beraten wir Sie in unserer Praxis diskret und persönlich.
Für Patientinnen in Oldenburg & Umgebung: Ihr nächster Schritt
Viele sexuell übertragbare Infektionen verlaufen still, lassen sich aber gut behandeln, wenn sie früh erkannt werden. Wer Veränderungen bemerkt oder ein Risiko hatte, sollte sich zeitnah untersuchen lassen. Sie kommen aus Oldenburg oder Umgebung? Bei Fragen oder Unsicherheit sind wir in unserer Praxis gern für Sie da. Vereinbaren Sie einen diskreten Termin bei Dr. med. Jana Stindt über die Online‑Terminvergabe oder telefonisch unter 0441‑42091.

FAQ – Häufige Fragen
Typische Warnzeichen sind neu aufgetretener oder stark veränderter Ausfluss (übelriechend, verfärbt, schaumig), Brennen beim Wasserlassen, Juckreiz, Schmerzen beim Sex, Zwischenblutungen sowie Bläschen oder Warzen im Intimbereich. Wichtig: Viele STI verlaufen ohne Beschwerden. Wenn Sie ein Risiko hatten (zum Beispiel Sex ohne Kondom mit neuem Partner), ist ein Test sinnvoll, auch ohne Symptome.
Ein Test empfiehlt sich nach ungeschütztem Sex mit neuem Partner, bei einem Partnerwechsel, wenn der Partner eine STI hat oder vor einer geplanten Schwangerschaft. Je nach Verdacht kommen Abstriche (zum Beispiel Chlamydien, Gonorrhö), Urintests, Bluttests (zum Beispiel Syphilis, HIV, Hepatitis B) oder ein HPV‑Test infrage. Ihre Frauenärztin bespricht das passende Vorgehen.
Nach einem kurzen Gespräch folgen, je nach Situation, Abstriche, Urin‑ oder Blutentnahmen. Erste Hinweise gibt die Untersuchung, das endgültige Ergebnis kommt nach der Laboranalyse. Einige Tests liegen binnen 1 bis 2 Tagen vor, Antikörpertests können je nach Fragestellung später aussagekräftig sein. Über die Befundmitteilung (Anruf, Termin, online) informiert Sie die Praxis.
Kondome reduzieren das Risiko für viele Erreger deutlich, besonders für Chlamydien, Gonorrhö, Syphilis und HIV. Bei Infektionen, die durch Haut‑zu‑Haut‑Kontakt übertragen werden (zum Beispiel Herpes, Feigwarzen/HPV), senken Kondome das Risiko, bieten aber keinen vollständigen Schutz, weil nicht alle Kontaktflächen abgedeckt sind. Lesen Sie auch unseren Artikel „Verhüten mit Kondom – 10 Mythen„.
Häufig ja. Bei Chlamydien, Gonorrhö oder Trichomoniasis ist eine Partnerbehandlung wichtig, sonst drohen „Ping‑Pong‑Infektionen“. Bei viralen Infektionen (Herpes, HPV, HIV) kann das Virus nicht wie ein Bakterium abgetötet werden. Hier steht die individuelle Beratung, Impfung (HPV) oder eine Therapie zur Kontrolle des Virus im Vordergrund.
Während einer akuten Infektion oder solange die Behandlung läuft, sollten Sie auf Sex ohne Kondom verzichten. Bei bakteriellen Infektionen gilt: erst wieder sexuelle Kontakte, wenn die Therapie abgeschlossen ist und Beschwerden abgeklungen sind; idealerweise nach ärztlicher Rücksprache. Bei Herpes ist die Ansteckungsgefahr während eines Ausbruchs am höchsten, pausieren Sie bitte bis die Haut vollständig abgeheilt ist.
Bitte melden Sie sich frühzeitig. Tests und Therapien werden an Schwangerschaft und Schwangerschaftswoche angepasst. Viele Infektionen lassen sich sicher behandeln oder unter Therapie so kontrollieren, dass Mutter und Kind gut geschützt sind. Die Praxis begleitet Sie engmaschig und stimmt das Vorgehen mit Geburtsklinik und gegebenenfalls Kinderärzten ab.
Bei bestimmten Konstellationen (zum Beispiel jährlicher Chlamydientest bis 25 Jahre, Vorsorge‑Pap, HPV‑Ko‑Test ab 35, Impfungen gemäß STIKO) werden die Kosten in der Regel übernommen. Individuelle Wunschleistungen oder erweiterte Tests können als Selbstzahlerleistung anfallen. Wir sagen Ihnen vorab, welche Kosten entstehen.
Nutzen Sie Kondome bei neuen Partnerschaften, prüfen Sie den Impfstatus (HPV, Hepatitis B) und vermeiden Sie übertriebene Intimreinigung. Bei wiederkehrenden Beschwerden lohnt sich eine Ursachenanalyse (zum Beispiel pH‑Wert, Begleitkeime, Diabetes, Medikamente). Offene Partnerkommunikation und gegebenenfalls gemeinsame Tests senken das Risiko erneuter Infektionen.
Bakterielle Infektionen (zum Beispiel Chlamydien, Gonorrhö, Syphilis) lassen sich meist vollständig behandeln. Virale Infektionen (zum Beispiel Herpes, HPV, HIV) bleiben oft lebenslang im Körper; Behandlungen lindern Beschwerden, senken Risiken oder unterdrücken die Viruslast. Parasitäre Infektionen (zum Beispiel Trichomoniasis) sind gut behandelbar, erfordern aber meist eine Partnertherapie.
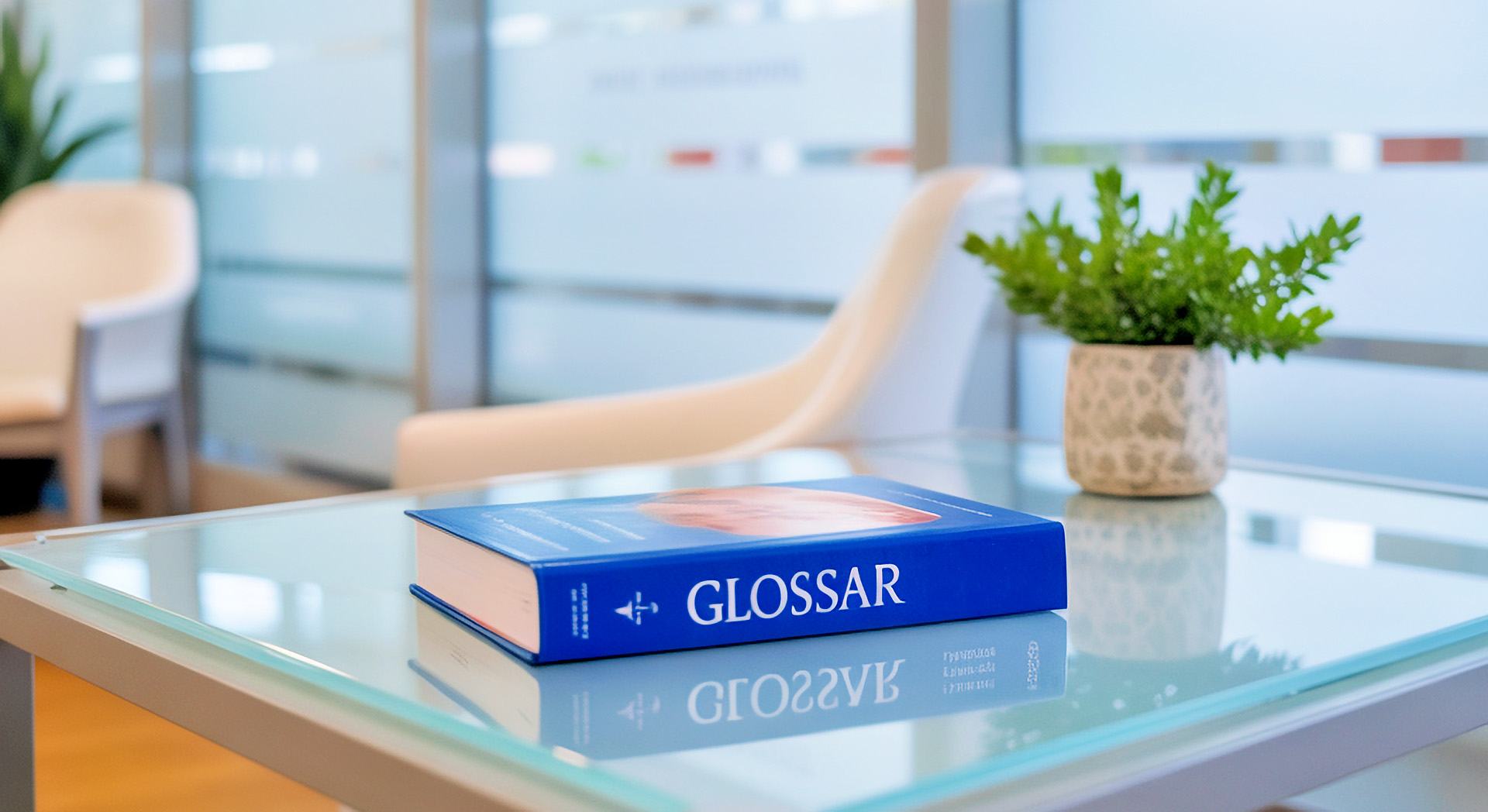
Glossar – Wichtige Fachbegriffe erklärt
- Antibiotikaresistenz: Widerstandsfähigkeit von Bakterien gegen Antibiotika. Sie entsteht unter anderem durch unnötige oder zu kurze Einnahme. Deshalb wird in der Praxis gezielt behandelt und die Einnahmedauer klar festgelegt.
- Antimykotikum: Arzneimittel, das Pilze hemmt oder abtötet. Es wird lokal als Vaginaltablette oder Creme angewendet oder bei komplizierten Verläufen als Tablette verordnet. Ziel ist es, Beschwerden rasch zu lindern und Rückfälle zu verhindern.
- Asymptomatisch: Eine Infektion liegt vor, verursacht aber keine spürbaren Beschwerden. Das ist bei STI häufig und erklärt, warum Tests auch ohne Symptome sinnvoll sein können.
- Barrieremethoden: Physische Schutzmittel wie Kondome, die Erregerübertragung über Körperflüssigkeiten und Schleimhautkontakt reduzieren. Sie sind eine Kernmaßnahme von Safer Sex.
- Beckenentzündung (PID): Aufsteigende Entzündung von Gebärmutter, Eileitern und Eierstöcken, oft nach unbehandelten STI wie Chlamydien oder Gonorrhö. Sie kann zu Verwachsungen und Unfruchtbarkeit führen und gehört ärztlich behandelt.
- Bakterielle Vaginose: Verschiebung der Scheidenflora mit dünnflüssigem, fischig riechendem Ausfluss. Sie ist keine klassische STI, kann jedoch das Risiko für andere Infektionen erhöhen und wird je nach Beschwerdebild behandelt.
- Fensterperiode: Zeitraum zwischen Ansteckung und der Möglichkeit, eine Infektion zuverlässig nachzuweisen (zum Beispiel bei HIV‑Antikörpertests). In dieser Phase können Tests noch negativ ausfallen, obwohl eine Ansteckung erfolgt ist.
- Inkubationszeit: Zeit zwischen Ansteckung und ersten Symptomen. Sie variiert je nach Erreger von Tagen bis Wochen und hilft, den Testzeitpunkt zu planen.
- NAAT/PCR: Nukleinsäure‑Tests wie die PCR weisen Erbmaterial eines Erregers direkt nach und sind sehr empfindlich. Sie kommen bei Chlamydien, Gonorrhö und Trichomoniasis häufig zum Einsatz.
- Partnerbehandlung/Partnerbenachrichtigung: Information und Mitbehandlung von Sexualpartnern bei bakteriellen STI, um erneute Ansteckungen zu vermeiden. Die Praxis bespricht Vorgehen und Zeitfenster diskret mit Ihnen.
- Pap‑Abstrich: Vorsorgeabstrich vom Gebärmutterhals zur Erkennung früher Zellveränderungen. Auffällige Befunde bedeuten nicht automatisch Krebs, erfordern aber eine engere Kontrolle. Der Test ergänzt sich mit dem HPV‑Test.
- Pap‑Dysplasie (zervikale Dysplasie): Zellveränderungen am Gebärmutterhals, oft durch persistierende HPV‑Infektionen. Sie heilen häufig von selbst aus, werden aber eng kontrolliert, um Vorstufen von Krebs rechtzeitig zu erkennen.
- PEP (Postexpositionsprophylaxe): Vorübergehende Medikamenteneinnahme nach einem HIV‑Risikokontakt, möglichst innerhalb von 24 Stunden (spätestens 48–72 Stunden). Ziel ist es, eine Ansteckung zu verhindern. Die Entscheidung trifft die Ärztin nach Risikobewertung.
- Präexpositionsprophylaxe (PrEP): Vorbeugende Einnahme von HIV‑Medikamenten vor Risikosituationen. Bei korrekter Anwendung reduziert sie das Ansteckungsrisiko deutlich und ergänzt Barrieremethoden.
- Rezidiv: Wiederauftreten von Beschwerden nach einer symptomfreien Phase, zum Beispiel bei Herpes oder Scheidenpilz. Die Praxis kann Rezidivstrategien und Trigger besprechen.
- Safer Sex: Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen, die das Risiko einer STI senken: Kondome, Lecktücher, gemeinsame Tests, Impfschutz und offene Kommunikation.
- Serologie: Blutuntersuchungen auf Antikörper oder Antigene, etwa bei Syphilis, HIV oder Hepatitis B. Sie ergänzt Abstriche und PCR in der Diagnostik.
- U=U (Undetectable = Untransmittable): Bei erfolgreicher HIV‑Therapie sinkt die Viruslast (Menge des Virus im Blut) unter die Nachweisgrenze. Dann wird HIV beim Sex nicht übertragen. Regelmäßige Kontrollen sichern diesen Status ab.
- Vaginalmykose (Scheidenpilz): Pilzinfektion der Scheide mit Juckreiz, Brennen und weißlich‑krümeligem Ausfluss. Häufig nach Antibiotika oder bei gestörter Scheidenflora. Meist helfen lokale Maßnahmen; bei Rückfällen wird nach Auslösern gesucht.
- Vulvovaginitis: Entzündung von Vulva und Scheide mit Juckreiz, Brennen und Rötung. Ursachen können Infektionen, Hauterkrankungen oder irritierende Pflegeprodukte sein und werden individuell behandelt.